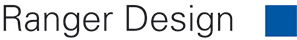|
Inszenierung und Erlebnis in kulturhistorischen Ausstellungen
Gespräch zwischen der Kunstwissenschaftlerin Dr. phil. Brigitte Kaiser und Kurt Ranger anlässlich der Dissertation von Dr. Kaiser: Inszenierung und Erlebnis in kulturhistorischen Ausstellungen. Museale Kommunikation in kunstpädagogischer Perspektive. (= Schriften zum Kultur- und Museums-management) Diss. Bielefeld 2006.
Was verbinden Sie inhaltlich mit Inszenierung?
Für mich ist entscheidend, dass die Inszenierungen dem Inhalt folgen. Für mich beginnt eine Ausstellung immer mit dem inhaltlichen Verständnis: Was sind die Botschaften und Kernaussagen, was wollen wir vermitteln?
Inszenierungen sind die Versuche, diese Inhalte zu vermitteln. Inszenierungen dürfen meiner Meinung nach keinen Selbstzweckcharakter haben, sie müssen versuchen den Inhalt einzugrenzen oder zu beschreiben.
Sind dies Inhalte, die von den Wissenschaftlern vorgegeben werden?
Richtig. Die inhaltliche Struktur musealer Ausstellungen kommt in der Regel von den Museumsleuten. Wir denken dabei natürlich mit, denn nicht jeder Inhalt lässt sich ausstellen, visualisieren oder gar inszenieren. Die Inszenierungen für die Mehrheit der Besucher sollen verständlich sein. Insofern ist es wichtig darüber zu diskutieren, was nun eigentlich die Botschaften sind. Es kommt natürlich vor, dass von unserer Seite Inhalte vorgeschlagen und diese dann noch hinzugefügt werden.
Zum Beispiel die 48er-Ausstellung: „Revolution in Baden". Nach der Flucht des Großherzogs folgte eine kurze Zeit der Demokratie in Baden – eine demokratische Zwischenform – bevor durch die Preußen die Revolution wieder niedergeschlagen wurde. Hier schlugen wir vor, die Feier dieses Zustandes zu zeigen. Wir stellten fest, dass aus dramaturgischen Gründen ein Freiheitsfest in der Ausstellung inszeniert werden muss. Ansonsten wäre in dieser Ausstellung der Sturz der Monarchie und die Niederschlagung der Revolution nahtlos ineinander übergegangen. Tatsächlich bestand historisch jedoch ein etwa 6-wöchiger, demokratischer Zwischenzustand, wenn auch mit anarchistischem Beigeschmack. Dies ist ein Beispiel dafür, dass ein inhaltlicher Vorschlag von unserer Seite in die Ausstellung aufgenommen wurde.
Achten Sie also darauf, einen dramaturgischen Bogen zu spannen?
Mir ist ganz wichtig, darauf zu achten, dass eine Ausstellung Höhepunkte hat und die Dramaturgie ausgewogen ist. Dies bedeutet, nicht am Anfang die Höhepunkte zu sammeln und zum Ende hin kann nichts mehr geboten werden. Die dramaturgische Gliederung ist folglich sehr wichtig.
Inszenierungen werden in der Fachwelt konträr diskutiert. Wo sehen Sie Grenzen dieser Methode?
Eine Inszenierung soll sich nicht vom Inhalt völlig ablösen, sie muss inhaltlich gebunden sein. Wenn eine Inszenierung zum innenarchitektonischen Schnickschnack wird und sich verselbständigt, auf modische Reize setzt und den Inhalt aus den Augen verliert, ist sie fehl am Platze.
Ist sie auch dann fehl am Platze, wenn versucht wird, atmosphärische Stimmungen zu erzeugen?
Atmosphäre ist legitim, aber sie muss natürlich wieder in Einklang mit dem Inhalt stehen. Das Ganze ist natürlich ein weites Feld. Man kann sich fragen: Was ist eine Inszenierung?
Genau. Ab wann beginnt für Sie Inszenierung?
Es beginnt letztlich schon dort, wenn ein Objekt auf einen Sockel gestellt wird. Im Museum jedoch stehen sehr viele Objekte auf Sockeln. Diese neutralisieren sich dann wiederum gegenseitig. Sie werden im Grunde gleich gewichtet. Wenn in einem Landesmuseum 20.000 Objekte ausgestellt werden und diese alle schön beleuchtet sind, dann ist dies dort der Normalzustand. Um aus dieser großen Anzahl einige wenige hervorzuheben, bedürfen diese einer besonderen Präsentation.
Persönlich sind mir alle Mittel recht, wenn sie dem Ziel dienen, die Botschaft besser zu vermitteln. Dies beginnt für mich schon bei der Präsentation des Objektes in einer Vitrine. Auch dort gibt es eine große Bandbreite von Mög-lichkeiten. Man kann Objekten illustratives Material beigeben, zum Beispiel zu einem Opferfund aus der griechischen Antike kann man Brandreste hinzugeben.
Dies bedeutet, dass Sie auch bei der Vitrinengestaltung mitwirken.
Hier beginnt eigentlich die Geschichte.
Aufgefallen ist mir in der Ausstellung, dass Sie versuchen, in den einzelnen Vitrinen kleine Geschichten zu erzählen.
Das ist sehr schön, wie Sie das sagen. Dies trifft genau den Punkt, den ich oft vorbringe. Im Idealfall müsste eigentlich jede Vitrine eine kleine Geschichte erzählen. Sie muss eigentlich die Geschichte dieser Objekte erzählen. Wir müssen hier nichts dazu erfinden.
Ich möchte zum Beispiel vermitteln, ob ein bestimmtes Objekt ein Massen-produkt oder etwas Exklusives dieser Zeit war. Wenn ich alles auf einen Sockel stelle, mache ich es gleichwertig. Viele heute erhaltene Keramiken der Griechen waren zur damaligen Zeit Alltagsware, also kann man diese als solche auch ausstellen. Es wäre wohl auch seltsam, wenn in 2000 Jahren jemand eine IKEA-Tasse auf einen Sockel stellen und sagen würde, dass diese ein exklusives Produkt des ausgehenden 20. Jahrhunderts war.
Haben Sie manchmal Kontroversen mit den Fachwissenschaftlern, zum Beispiel Kunsthistorikern?
Oft ist es ein Kommunikationsproblem. Grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass ich mit Historikern keine Probleme habe, diese denken ähnlich wie ich. Kunsthistoriker sind schwieriger. Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit zum Beispiel am badischen Landesmuseum kennt man mittlerweile unsere Arbeitsweise. So können Ideen leichter vermittelt werden und stellen sich nicht mehr der Diskussion. Man kann auf einer anderen Ebene diskutieren. Dinge, die in der Anfangsphase diskutiert wurden, sind heute bereits geklärt. Die Inszenierung als solche wird nicht in Frage gestellt.
Grund dafür ist zum einen, dass diese Form vom Publikum gut angenommen wird und zum anderen, dass die Vermittlung der Inhalte funktioniert. Dies wird auch von den Untersuchungen und Besucherbefragungen von Prof. Klein bestätigt. Er belegte durch seine Umfragen, dass die Ausstellungen, die wir gestaltet haben, eine höhere Publikumsakzeptanz haben, als Ausstellungen, die dort schon früher von anderen Leuten gemacht wurden oder Ausstellungen anderer Museen, ohne eine Museumsschelte betreiben zu wollen.
Eine unkonventionelle Art der Vermittlung im Landesmuseum sind kurze Theaterszenen in der Ausstellung.
Dies ist ein Stilmittel, welches wir zum ersten Mal in der 48er-Ausstellung verwendeten. Dort wurde es mit sehr großem Erfolg zum ersten Mal umgesetzt. Schauspieler spielen während der Ausstellung – natürlich mit Unterbrechungen – vor theaterähnlichen Kulissen. Der Unterschied zum Theater besteht darin, dass der Zuschauer sitzt und die Bühne verändert sich. Im Gegensatz dazu geht der Besuchende durch die Ausstellung und trifft an verschiedenen Stellen die Schauspieler. Dies kam sehr gut an. Aus diesem Grund wurde diese Idee, die von mir stammt, weiterverfolgt. Dies entwickelte sich mittlerweile fast zu einem Art „Markenzeichen".
Der Begriff Inszenierung leitet sich aus dem Theaterbegriff „in Szene setzen“ ab.
Noch mal zur Klärung des Begriffes „in Szene setzen". Darüber kann man viel reden. Im Ausstellungsbereich bleibt dieser Begriff letztendlich unscharf. Meiner Meinung nach bedeutet Inszenierung, wenn eine raumartige Installation entsteht und diese eine Botschaft vermitteln soll. Ich vergleiche dies mit einem Stück gefrorener Zeit. Ich fasse einen Zeitabschnitt aus der Vergangenheit und den rekonstruiere ich. Dies ist natürlich einzuschränken, weil letztlich eine Rekonstruktion unmöglich ist.
Wenn nun dieses Büro in seinem momentanen Zustand in ein Museum transportiert werden würde, dann könnte der Betrachter spüren: Hier wird gearbeitet. Die Arbeitssituation ist die Botschaft. In einem Möbelhaus müsste dieses Büro in Richtung Lifestyle verändert, quasi veredelt werden, dies wäre dann eine andere Botschaft.
Die gefrorenen Momentaufnahmen sind die einfachste Form der Inszenierung, die ich schätze und sehr gerne mache. Dazu gehören aber auch kommunikative Elemente, wie Text- und Bildinformationen oder Ton, wie z. B. vielleicht auch Hörspiele, damit dieser Raum noch kommunikativer wird.
Dies bedeutet, Sie sehen Text als wesentlichen Bestandteile für das Verständnis der Inszenierung. Sie vertrauen nicht auf die Erzählkraft der inszenierten Bilder.
Ohne Text bleibt eine gewisse Unschärfe. Text kann auch nur eine Überschrift sein. Bei vielen Texten halte ich die Überschriften für das Wichtigste. Nicht jeder Besucher liest die ganzen Texte. Dabei achten wir natürlich auch darauf, dass gewisse Textmengen nicht überschritten werden. Wichtig sind mir gute Überschriften. Auch arbeite ich gerne mit eingestreuten, zeitgenössischen Zitaten.
Sehen Sie eine Gefahr, dass mit zuviel an Beiwerk um das museale Objekt an sich, dieses an Besucheraufmerksamkeit verliert?
Dies ist ein Balanceakt. Kommen wir auf die Spätmittelalterausstellung zu sprechen. Der Ausstellungstitel lautete „Alltag, Handel, Handwerk", das heißt, es wurden keine spektakulären Objekte, sondern Alltagsgegenstände ausgestellt. Die staatliche Kunsthalle im Gegenzug stellte parallel zu unserer Ausstellung sehr wertvolle Exponate aus. Viele unserer Objekte war schlicht und unspektakulär, wie zum Beispiel ein verrostetes Teil einer Mistgabel, ein halber Holzlöffel, ein Holzrohr einer Wasserleitung. Bei diesen Objekten macht es auf alle Fälle Sinn, diese in einen inszenierenden Kontext zu bringen, die ihren Ursprung und Funktion verdeutlichen.
Konkret im Fall der Ausstellung fertigten wir Fotos von heutigen Situationen zum Beispiel von einem Wald an, der wohl einem mittelalterlichen Wald entspricht. Auch heute gibt es noch derartige Bann- und Schutzwälder. So konnten wir dem Besucher vermitteln, wie zur Zeit des Spätmittelalters ein Wald aussah, der im Vergleich zu heutigen Wäldern nicht durchforstet war. Durch diese fotografischen Elemente rückt das Mittelalter meiner Meinung nach näher an die Besucher heran. Auch heute gibt es noch Getreidefelder. Doch diese sehen anders aus, durch Pestizide und Züchtung ist das Getreide größer und voller. Aber es ist auch nicht völlig aus der Welt. Der Besucher erkennt, aus welchen Ressourcen der damalige Mensch gelebt hat. Dies vermittelt sich ihm relativ plakativ, ohne tief zu forschen.
Zweifellos ist die Wahrnehmung der durchrosteten Mistgabel durch das dahintergestellte Bild gestört. Doch gibt es für mich bei solch einem Objekt nicht derart viel anzuschauen.
Zurück zur Kunsthalle und deren Kunstwerken, es wäre doch auch möglich gewesen, diese zu inszenieren. Wenn Sie einen Auftrag von der Kunsthalle gehabt hätten, wie wären Sie hier vorgegangen?
Ich arbeite auch für die Kunsthalle, jedoch nicht als Ausstellungsgestalter, sondern als Designer für die Werbemedien.
Es wäre doch auch spannend gewesen, dort zu inszenieren.
Dies ist richtig. Doch die staatliche Kunsthalle wünscht keine Inszenierung, insofern ist dies für mich müßig darüber nachzudenken, weil derartige Projekte immer im Team mit dem Auftraggeber entstehen. Einschränkend muss man den Kunsthistorikern auch recht geben. Die gemalten Kunstwerke als Einzel-objekte sind für sich eine Inszenierung. Dies sind keine Fotographien, sondern Konstruktionen, die dem damaligen Denken des geistigen Bereichs ent-sprochen haben. Sie sind vollgepackt mit Symbolen und Botschaften, die wir vielleicht heute nicht mehr verstehen. Den damaligen Menschen jedoch war dies wahrscheinlich vertraut. Dies sind gemalte Szenen. Diese Bilder brauchen keine starke Inszenierung, um an sich zu wirken.
Aber es ist natürlich so, was mir damals als Idee spontan kam, dass in der Zeit der Reformation viele Bilder verbrannt wurden. Wäre man noch auf dieses Thema eingegangen, hätte ich es gut gefunden, noch Brandreste und Leer-stellen mit auszustellen, um deutlich zu machen, welch Kulturgut damals verloren ging.
Inszenierung ist eine Sache, die den Inhalt unterstützen muss. Zweifellos lässt sich im Museumsbereich noch vieles denken, wobei der Museumsbereich eher konservativ orientiert ist – auch das Badischen Landesmuseum, die zweifelsfrei schon sehr weit gehen. In diesem Bereich könnte ich mir manches noch ganz anders vorstellen.
Was könnten Sie sich in Bezug auf weniger konservatives Vorgehen vorstellen?
Es wäre möglich, noch viel öfter aktuelle Zeitbezüge in die Ausstellung einzuarbeiten. In Bezug auf die Kunsthalle hatte ich hier die Idee des Märtyrers. Es stellt sich die Frage, wer ist eigentlich ein Märtyrer. Es werden Märtyrer in gemalter Form ausgestellt, doch es gibt auch in unserer Zeit Märtyrer, bzw. zumindest Personen, die man für Märtyrer hält, zum Beispiel Leute, die im Widerstand gegen das Dritte Reich ums Leben kamen bis hin zu dem kleinen Jungen, der vor wenigen Tagen in Palästina erschossen wurde.
Dies würde natürlich der gesamten Ausstellung eine neue, eigene Dimension geben.
Aber dies würde mich zum Beispiel interessieren. Eine Möglichkeit über Märtyrer und Heilige in anderer Form nachdenken. Was sind dies für Menschen? Sind dies Konstruktionen von uns? Was sagt die Kirche hierzu? Haben wir heute auch Heiligen-Figuren? Ist etwa Boris Becker eine heilige Figur?
Speziell diese Gegenwartsbezüge oder kritischere Hinterfragung des Mittelalters vermisste ich in der Ausstellung „Spätmittelalter am Oberrhein“. Die Vergangenheit wurde befragt, aber es wurde nicht die Frage gestellt: Welche Bedeutung hat diese Geschichte für uns in der Gegenwart? Warum befasst man sich mit Geschichte? Wir stellen die Fragen der Vergangenheit neu. Man will alle Besucher erreichen, dies war wohl der Fall. Doch man will den Besucher nicht nur erreichen, sondern auch ein Stück weiterführen.
Dies liegt natürlich immer am Konzept einer Ausstellung. Ich denke, dass man in Zukunft auch über andere Konzepte nachdenken muss, die vielleicht auch herausgelöst sind aus diesen zeithistorischen Epochen und sich mit thematischen Schwerpunkten befassen.
Nun zu einem weiteren Aspekt. Es gibt auch Künstler, die Ausstellungen gestalten. Wie stehen sie dazu?
Ich kann wenig dazu sagen, da ich selbst derartige Ausstellungen noch selten besucht habe, aber grundsätzlich warum nicht. Ich selbst sehe mich als Designer, nicht als Künstler, das heißt mit mir kann man über alles reden. Ich versuche in Gesprächen die Gestaltungsidee zu entwickeln. Natürlich habe ich auch meine Vorstellungen und ich kann mich gut durchsetzen.
Haben Sie Leitprinzipien oder vertreten Sie einen eigenen Stil?
Wir verfolgen einen gewissen Stil, aber wir versuchen, diesen stetig weiter zu entwickeln. Ich sehe mich als „Erfinder-Designer“.
Was hat sich beispielsweise von der 48er-Revolutions-Ausstellung im Vergleich zur Spätmittelalterausstellung verändert?
Dies hängt mit den Leuten und der Art der Zusammenarbeit zusammen. Das 48er-Team war mit viel innerpolitischem Engagement und Herzblut an der Sache. Dies hat sich in der Ausstellung in einer gewissen Radikalität der Aussage „pro-Revolution" niedergeschlagen. Dementsprechend war diese Ausstellung patriotisch. Sie war eingefärbt in die Farben Schwarz, Rot und Gold. Hier war mir persönlich wichtig, dass die Nationalfarben wieder an die Demokraten zurückkommen.
Dies bedeutet, Sie waren vom Mittelalter weniger emotional berührt.
Schon auch, aber nicht in dieser persönlichen Berührtheit, wie vergleichsweise dies bei der Thematik der 48er-Revolution der Fall war.
Obgleich das Mittelalter auch genügend Stoff für Emotionen bieten würde, gerade die mittelalterliche Mystik.
Dies war jedoch nicht Thema. Es ging um Alltag, Handwerk und Handel. Die Ausstellung „Spätmittelalter" war wohl etwas kühler und distanzierter. Dennoch war sie, was die Detailausgestaltung zum Beispiel die Vitrinengestaltung betraf, perfekter durchgearbeitet. Weitgehend jede Vitrine war mit liebevollen Details gestaltet. Gerne hätte ich auch die Mittelalterausstellung noch intensiviert. So hatten wir vor, in der Kirche eine Projektionsfläche mit Kirchenmusik im Hintergrund anzubringen. Es sollten höllisch-dämonische Aspekte, aber auch himmlische Verheißungsmotive auftauchen. Die Kirche zur damaligen Zeit war einerseits Schutzraum für Menschen, aber genauso wurde durch die kirchliche Lehre ein gewisser Bedrohungszustand erzeugt, zum Beispiel die Gegenüber-stellung der Himmel- und Höllevorstellung. Dies war vorbereitet, doch wie so oft gibt es Kostenprobleme. Es wurde auch nicht mehr gewünscht. An dieser Stelle ging wohl auch an einigen Stellen im Team der Elan aus. Dieses emotionale Element hätte ich jedoch gerne noch gehabt.
Wie wichtig sind Ihnen die sinnlichen Momente neben den kognitiven Elementen?
Beides ist mir sehr wichtig. Alle Sinne soll wirklich alle Sinne heißen, nicht nur den Sehsinn, sondern auch Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen. Sehr gerne mache ich auch Hörspiele, nicht nur mittels Acousticguide, sondern auch die Möglichkeit, bei Betreten eines Raumes oder Drücken eines Knopfes einen Dialog zu hören. Wenn möglich sollten auch der Geschmacks- und Geruchssinn angesprochen werden.
Wie setzen Sie dies um?
Im Labyrinth des Minos gab es zum Beispiel am Schluss ein eingebautes Kafenion. Dort konnte der Besucher wunderbare, griechische Häppchen essen. Zum Riechen gab es zum Beispiel Kräuter und medizinische Präparate. Eine Ausstellung sollte durchaus auch etwas stinken, was natürlich schwierig ist. Zum Anfassen gab es das Kettenhemd. Auch der Gleichgewichtssinn kann angesprochen werden, zum Beispiel mittels einer schiefen Ebene. Dies ist eine Möglichkeit den Besucher zu irritieren, vorausgesetzt es passt zum Thema.
Ich mag jedoch keine Ausstellungen, die sich dem normalen Besucher nicht erschließen. Wenn man Kunsthistoriker sein muss, um eine gewisse Verschlüsselungsebene verstehen zu können, langweilt mich dies, ehrlich gesagt. Zum Beispiel: Ein historischer Schreibtisch mit entsprechendem Volumen, der etwas schräg auf einem Podest steht, soll sagen: „Dies ist das Ende der Zeit – die Zeit kippt.“ Das ist einerseits zu banal und andererseits zu abstrakt. Ein Besucher muss schon sehr wach sein, um dies überhaupt wahrzunehmen. Da es im Normalfall nicht erlaubt ist, dass dieser Schreibtisch wirklich kippt oder zerbrochen auf dem Boden liegt, kann nur minimal angedeutet werden. Eine Neigung von mehr als zehn Grad ist nicht möglich, da der Tisch Schaden nehmen und sich verziehen könnte. Diese dezenten Aussagen und Deutungen finde ich einfach langweilig.
Es kommt nicht selten vor, dass Gestalter ein tolles, intellektuelles Konzept haben – die gewünschte Botschaft jedoch den Besucher nicht erreicht.
Dies liegt auch an den Kunsthistorikern, die sich oft schon selbst als Gestalter begreifen und Dinge nach ihren Vorstellungen ausstellen wollen, die aber in dieser Form nicht funktionieren.
Es gibt oft sehr interessante, komplexere Gestaltungskonzepte, die sich jedoch nicht sofort jedem Besucher erschließen und somit erklärungs-bedürftig wären. Wäre es nicht eine Möglichkeit, die Gestaltungsidee dem Besucher ebenfalls zu vermitteln, statt darauf zu vertrauen, dass der Besucher diese schon verstehen werde. Sollte die Gestaltungsidee, nicht auch an den Besucher kommuniziert werden, zum Beispiel mittels Texttafel oder Flyer. Oft werden die Gestalter nicht einmal namentlich erwähnt.
Dies ist tendenziell richtig. Dieser Aspekt ist mit Sicherheit nicht so sehr im Bewusstsein.
Ich verfolge die Rezensionen in der Presse. Vereinzelt wird auch konkret auf die Gestaltung eingegangen, doch in der Summe betrachtet konzentriert sich die Mehrheit der Rezensenten auf die inhaltliche Beschreibung.
Das Bewusstsein auf diesem Gebiet ist noch nicht weit ausgebildet. Dies liegt mit Sicherheit an der Art wie die Gestalter auftreten, somit liegt es auch an mir. Wenn ich mich mehr der Öffentlichkeit stelle und bei der Pressekonferenz anwesend bin, bin ich auch mehr in den Medien vertreten. Es liegt aber auch daran, wie diese Ausstellung von Seiten des Museums mittels Pressetexten verkauft wird.
Bei der 48er-Ausstellung drängte ich darauf, bei der Pressekonferenz dabei zu sein. Dies ist nicht immer der Fall. Wir konzipierten den Ausstellungsprospekt mit dem doppeldeutigen Slogan „die Revolution kommt ins Museum". Dies bezog sich nicht nur auf die Inhalte der Ausstellung, sondern auch auf die andere Art der Präsentation. In der Folge hatten wir viele namentliche Nennungen in der Presse und Artikel, die explizit auf die Ausstellungsgestaltung eingingen. Dies fällt natürlich mit einer aus dem Rahmen fallenden Ausstellung leichter. Generell entspricht es jedoch nicht meinem Wesen, mich in den Vordergrund zu spielen. Primär begreife ich mich als Teamarbeiter.
Auch dies unterscheidet Sie wohl von manchen Künstlerpersönlichkeiten, die sich durchaus gerne manchmal in Szene setzen.
Es stellt sich die Frage: „Wie sehr spannt man den Bogen?" Man kann mehr Dinge erreichen. Wobei die Presseleute meist das schreiben, was man ihnen vorkaut. Oft findet keine intensive Beschäftigung mit der Sache statt. Kommentare zu Ausstellungsgestaltung sind – wenn sie überhaupt in Rezensionen zu finden sind – oft unqualifiziert, weil geschmäcklerisch. Das Konzept der Vermittlung scheinen sie nicht richtig begriffen zu haben.
Dies trifft wieder den Punkt, dass auch Gestaltung an sich oft erklärungsbedürftig wäre. Nun noch zu einem weiteren Thema: Welche Bedeutung hat für Sie Teamarbeit?
Eine Ausstellung kann immer nur so gut sein wie das Team. Ein kreativer Designer, aber ein träges Wissenschaftlerteam werden keine hervorragende Ausstellung schaffen. Ebenso wenig werden ein aufgeschlossenes Wissenschaftsteam und ein unsensibler Designer keine wirklich gelungene Ausstellung verwirklichen können.
Gibt es auch Museumspädagogen im Team?
Ich sage immer, ich besorge das Geschäft des Museumspädagogen mit. Aber Museumspädagogen sind zum Teil auch im Team dabei. Ich denke ähnlich wie Pädagogen im Sinne von Vermittlung und zielgruppenorientierter Ansprache. Wobei wir die Dinge oft konsequenter durchdenken als die Museums-pädagogen. Was mir persönlich zum Beispiel wichtig ist, dass bei Hands-on-Bereichen Blätter zum Durchblättern nicht nur aufliegen, sondern dass dieses wiederum in die Thematik eingebunden und passend zum Thema großzügig ausgestellt wird, beispielsweise die Papierherstellung. Bei einem Kettenhemd, das der Besucher anfassen und heben kann, wäre mir am liebsten, er könnte dies auch anziehen, was jedoch organisatorische Probleme mit sich bringt.
Kam es auch vor, dass von der pädagogischen Seite nochmals in bestimmten Bereichen Dinge als notwendig gefordert wurden?
Eine Ausstellung entwickelt sich im ständigen Dialog. Wir fragen nach Wünschen an bestimmten Stellen. Dementsprechend werden museums-pädagogische Belange in den Entwicklungsprozess integriert. Der Inhalt wird zur Form und am Ende ergibt sich eine Einheit. Dies sind nicht zwei Seiten einer Medaille, sondern Inhalt und Form sind identisch. Man kann nicht am Ende sagen, jetzt kommt noch etwas dazu.
Somit verstehen Sie sich selbst als jemand, der pädagogisch denkt.
Vermittelnd, aber nicht erzieherisch. Ebenfalls wichtig ist mir eine konzentrierte Vermittlung der Botschaften. Uns stehen Objekte, Texte, Text-Bild-Informationen, Zitate, Inszenierungselemente in leichter, mittlerer und starker Form, audiovisuelle Elemente, Beleuchtung zur Verfügung. Mit diesem Instrumen-tarium spielen wir. Eine Botschaft soll aber auch nur einmal vermittelt und nicht zehn Meter weiter wiederholt werden. Darauf lege ich großen Wert. Dies führt manchmal zu Kämpfen. Ich sehe keinen Sinn darin, ein Thema an einer Stelle zu erklären und dieses auf der anderen Seite mittels Videogerät ein weiteres Mal zu erzählen. Auch aus diesem Grund ist eine Integration der museums-pädagogischen Dinge sehr wichtig, damit eine Vermittlung der Botschaften gebündelt und moderiert erfolgt. Bequemer ist es natürlich zu sagen, ihr habt diese Spielwiese, wir toben uns auf einem anderen Gebiet aus. Doch alles in allem sollte das Endergebnis aus einem Guss sein.
In der klaren Bündelung und Verdichtung der Information liegt mit Sicherheit eine große Herausforderung an alle Beteiligten.
In der Moderation des Prozesse sehe ich einen wichtigen Teil meiner Aufgabe. Manchmal fühle ich mich wie im diplomatischen Dienst. Ich koordiniere Museumsleute und versuche einen gemeinsamen Konsens zu finden im Sinne eines Projektleiters. Dies ist zwar als Gestalter nicht meine Aufgabe, aber trotzdem im Sinne des Zusammenarbeitens und gemeinsamen Wirkens mache ich diese Aufgabe manchmal mit.
Sehen Sie eine Gefahr, dass sich Museen den kommerziellen Themenparks, wie zum Beispiel Europapark Rust oder Disneyworld annähern, die rein auf den Faktor Unterhaltung und Spaß setzen?
Ich sehe an sich kein großes Problem. Spaß und Lust am Erleben ist generell etwas Schönes. Bei der Vermittlung ist Spaß etwas sehr Positives. Man braucht nur den Blick auf die Begeisterungsfähigkeit der eigenen Kinder zu werfen. Wenn es gelingt, diese Begeisterung für die Vermittlung auszunützen ist dies toll. Die Kombination von Wissensvermittlung und Langeweile halte ich für schädlich.
Sehr wichtig ist, darauf zu achten, dass nicht Originale und Kopien vermischt werden. Das Museum lebt von den Originalen. Hier liegt seine Kernkompetenz. Manche sprechen von der Aura des Originals. Diese stellt sich nicht immer ein. Bei einem mittelalterlichen Holzlöffel ist dies wohl weniger der Fall, als bei einem liturgischen Gerät, welches schon vor Jahrhunderten mit der Intention, eine Aura zu erzeugen, angefertigt wurde. Auch ein Hemd eines Soldaten mit Blutspuren strahlt in Verbindung mit der Biographie dieses Menschen Anrührendes aus. Aus diesem Grund sollte man bei der Arbeit mit Originalen stark darauf achten, diese streng von Repliken und Rekonstruktionen zu trennen. Wir wollen in keine Vergnügungsstyroporecke kommen, wie man dies zum Beispiel in den nachgebauten Räuberhöhlen der Vergnügungsparks findet. Wir arbeiten bei unseren Inszenierungen immer mit Stilisierung, damit es nicht zu echt wirkt. Den Einbau von Pflastersteinen in eine Vitrine, der eine pseudooriginale Situation erzeugen soll, lehne ich zum Beispiel ab.
Stellt das Element der Stilisierung einen zentralen Punkt in ihren Inszenierungen dar?
Hierin sehe ich eine ästhetische Qualität. Stilisierung gibt es in unterschiedlichen Graden. Auch eine Rekonstruktion ist möglich, doch soll diese deutlich als solche gekennzeichnet sein.
Ziehen Sie hier eine klare Abgrenzung zu Themenparks?
Themenparks sind generell anders konzipiert. Sie erfinden Geschichte, die Vergangenheit wird mit Phantasie verwoben. Dies äußerst sich in Nach-stellungen von konkreten Situationen mit sich bewegenden Puppen und rollenden Augen.
Bei systematischer Betrachtung lassen sich bestimmt Überschneidungen finden. Würde man dies auf einer Skala mit den Extrempunkten Disneyland hundert Prozent und klassisches Museum Null Prozent betrachten, so könnte man sicherlich in manchen Bereichen Berührungspunkte entdecken. Im Kern geht es im Museum jedoch immer um die Originale. Bei Vergnügungsparks spielen diese keinerlei Rolle. Dies ist der wesentliche Unterschied. Hier müssen Museen sicherlich aufpassen, dass sie sich entsprechend positionieren und ihre Kernkompetenz nicht kaputtmachen.
Die Erweiterung der Museen und Verwirklichung szenographischer Konzepte mit Multimedia Installationen, Tanz und Choreographie lenkt von den Kern-kompetenzen der Museen ab. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Expo 2000 in Hannover? Blickt man hundert Jahre zurück, gingen immer wieder gestalterische Impulse von den Weltausstellungen aus, die später in Museen zu sehen waren, beispielsweise die lebensweltlichen Darstellungen.
Die Expo war für mich ein klassischer Fall von viel Verpackung und kein Inhalt. Sie war für mich eine große Enttäuschung. Viele Designer wurden losgelassen, doch die Inhalte fehlten. Für mich gab es auf der Expo nichts zu entdecken, was als wirklich zukunftsträchtig für das Museum bewertet werden kann.
Bewerten Sie somit die Expo als großes Szenario ohne langfristige Wirkung?
Überspitzt gesagt, war es für mich ein großes, aufgeblasenes Nichts, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Bei der Arbeit mit vielen Medien wie Film, Projektionen, Bewegungselementen werden die Botschaften nicht einfacher. Es wirkt modern und ist vielleicht auch teuer und kann große Ausstellungshallen füllen. Dann stellt sich oft die Frage, ob der gleiche Inhalt nicht auch auf zwanzig Quadratmeter gezeigt hätte werden können.
Bezug nehmend auf die Diskussion um veränderte Wahrnehmungsformen, könnte es nicht sein, dass die nachwachsende Generation durch Filme und Projektionen mehr angesprochen wird?
Angesprochen werden dadurch vielleicht viele Menschen, aber – und hier komme ich wieder zurück auf die anfänglich besprochenen Thesen – es geht um die Frage der Botschaften. Man kann Wetterkarten im Fernsehen heran-fliegen lassen und virtuelle Flüge von Stuttgart nach Hamburg zeigen, doch im Grunde genommen ist dies überflüssig. Die Frage – wie wird das Wetter morgen – ist damit noch nicht beantwortet. Je mehr in dieser Richtung kommt, wird sich auch eine Gegenbewegung formieren. Dies ist das, was wir hier auch machen.
Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung von Inszenierung und Erlebnissen in Museen?
Ich denke, dass sich die Entwicklung weiter fortsetzen wird. Man wird künftig noch mehr Energie in Inszenierungen stecken. Es wird sich ein Qualitäts-bewusstsein in Hinblick auf gute und schlechte Inszenierungen entwickeln. Das würde ich mir wünschen. So wie man im Theater mehr über die Inszenierung spricht, als über das Stück als solches. Ganz lässt sich dies zwar nicht vergleichen, da im Ausstellungsbereich immer wieder neue Themen präsentiert werden. Otto der Große wird sicher nicht nächstes Jahr in neuer Inszenierung in Hamburg ausgestellt.
Dieses konkrete Thema nicht, doch Themenausstellungen zum Mittelalter wird es sicherlich auch in zehn, zwanzig Jahren wieder geben.
Man wird wohl noch mehr in Richtung Event denken, wenn man Erfolg haben will. Und Erfolg wird für Museen immer wichtiger werden, da ihre Finanzmittel potentiell reduziert werden. Das heißt, Einnahmen müssen in die Museums-kasse zurückfließen, um vielleicht auch noch kleinere Kabinettausstellungen mit schwierigeren Themen verwirklichen zu können.
Glauben Sie, dass sich der größere Erfolg der Museen nur einstellen kann, wenn sie sich noch mehr dem sogenannten Event öffnen?
Der Begriff Event ist ein sehr unpräziser Begriff, man sollte überlegen, was ist dies überhaupt? Sie beziehen sich auch auf die „Kaltenberger Ritterspiele". Einige dieser Schauspieler sind zum Beispiel auch bei einer Aktion des Landesmuseums aufgetreten. Hier finden sich Schnittstellen. Die Aufgabe des Museums liegt jedoch darin, die Geschichte des Mittelalters präziser zu beschreiben. Dies bedeutet, nicht das Rittertum, welches eine aussterbende Randerscheinung im Spätmittelalter war, in den Mittelpunkt der Ausstellung zu stellen, sondern das aufstrebenden Bürgertum. Hier liegt der Unterschied. Museen müssen das historische Bild präziser, exakter und korrekt vermitteln. Das Museum sollte kein Event nur um des Events willen aufführen, wie zum Beispiel spektakulär aufeinanderzustürmende Ritter. Dies würde am Thema vorbeigehen. Doch ein Event im Sinne eines mittelalterlichen Marktes, auf dem Handwerker mit spätmittelalterlichen Methoden und Werkzeugen arbeiten, wäre meiner Ansicht nach legitim. Auch dies ist für Besucher spannend. Hier liegt die Anforderung an das Museum.
Vielen Dank für das Gespräch!
|